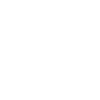Jetzt hilft nur noch eins: Brüllen, aus voller Kehle. „Ich glaube, das wird uns allen helfen“, sagt die Organisatorin und beginnt zu zählen: drei, zwei, eins. Dann fangen alle zu schreien an, so laut sie können. Die Gesichter sind verzerrt vor Anstrengung, die Augen geschlossen. Drei Sekunden lang schreien sie ihren Frust, ihre Wut, ihre Angst heraus. „Das hat gutgetan“, sagt die Organisatorin, als die Gesichter sich wieder entspannen. Einige Körper beben nach vor Erschöpfung.
33 Menschen, vor allem Frauen haben sich im Hinterzimmer einer gut besuchten Bar in Brooklyn versammelt, um ihre Stimme zu erheben. Um zu hören, wie laut sie ist, wie viel Kraft sie hat. Fünf Tage zuvor haben sie ihre Stimmen im Wahllokal abgegeben und mitansehen müssen, dass sie nicht gereicht haben. Wie 95 Prozent der Wähler in diesem Teil von New York haben sie für Hillary Clinton gestimmt. Gewonnen hat dennoch Donald Trump.
Das gemeinsame Schreien in der Bar ist ein Ausgleich für die Stille, die sich in der Wahlnacht über die Clinton-Wähler legte. Am Times Square zum Beispiel, als über die Bildschirme die Nachricht flimmerte, dass Donald Trump im Bundesstaat Ohio gewonnen hatte. Ein Ausgleich für die Jubelschreie, die fest eingeplant waren und doch ausfielen, als Trump auch die traditionell demokratischen Bundesstaaten Pennsylvania und Wisconsin gewann. Statt Jubel gab es Tränen.

Seit dem Wahlsieg von Donald Trump zieht sich ein Riss durch Amerika: Auf der einen Seite die jubelnden Trump-Fans, auf der anderen zum Beispiel die Menschen, die sich in Brooklyn frei zu schreien versuchen. Wie kann diese Kluft zwischen Demokraten und Republikanern, der divide, überwunden werden? Das ist nun die große Frage; der amtierende Präsident Barack Obama, die Fast-Präsidentin Clinton, der Bald-Präsident Trump: sie alle haben sie in den vergangenen Tagen gestellt. Es ist eine Kluft, die die Gesellschaft spaltet: in den Köpfen und auf der Landkarte.
Dass die Kluft immer tiefer wird, daran haben die Parteien einen entscheidenden Anteil. Seit Jahren rücken die Republikaner weiter nach rechts, die Demokraten nach links. In zentralen Fragen wie Einwanderung, Rassismus und Klimawandel liegen die Ansichten ihrer Anhänger immer weiter auseinander.
Auch räumlich ist die Zweiteilung offensichtlich. Vor 60 Jahren noch gab es keinen Unterschied im Wahlverhalten zwischen ländlichen Gegenden und Städten. Heute sind Städte Hochburgen der Demokraten, das Land hingegen wählt republikanisch, besonders die Bundesstaaten in der Mitte des Landes, die als flyover states verspottet werden.
All diese Entwicklungen sind seit Jahren bekannt. Was in diesem Jahr dagegen neu war: Trump kämpfte beinahe ausschließlich für die weiße Wählerschaft. Wenn Ausländer in seiner Kampagne auftauchten, dann vor allem als Kriminelle. Muslime wurden in erster Linie als terroristische Gefahr dargestellt, Schwarze als gebeutelt vom Leben in chaotischen Zuständen in gefährlichen Gegenden. Demokraten kritisieren diese Aussagen als rassistisch und islamfeindlich. Menschen, die in der Bronx und in Harlem leben, sprechen von einem “furchterregenden” Wahlkampf.
Für Trump hat es sich gelohnt. Die Weißen in den USA sind eine schwindende Mehrheit, aber eben immer noch: eine Mehrheit. Sie stellen 70 Prozent der Wähler und haben sich klar für Trump entschieden, 58 zu 37 Prozent . Den Weißen verdankt Trump seinen Sieg.
Auf den ersten Blick erscheint die amerikanische Landkarte nach der Wahl übersichtlich. Da die roten, hier die blauen. Doch der Riss zieht sich durch alle Staaten. Oft wird vergessen, dass Hillary Clinton auch in einem Bundesstaat wie Texas, in dem seit 1980 Republikaner gewinnen, auf 43 Prozent der Stimmen kam. Und auch in New York findet man Trump-Fans, nur eben nicht am Times Square oder in Brooklyn, sondern in Staten Island. Mit der Fähre ist es keine halbe Stunde von Manhattan. Hier sind die Republikaner unter sich. Republikaner wie Sam Pirozzolo.
Noch weiß Pirozzolo nicht, dass Donald Trump die Wahl gewinnen wird. Es ist Sonntag, zwei Tage vor der Entscheidung. Pirozzolo steht an einer Straßenkreuzung, gemeinsam mit 100 weiteren Menschen. Sie glauben fest an Trumps Sieg. Es sei „unglaublich“, wie viele sich am Wahltag für ihn entscheiden würden. Ihre Worte sind kaum zu verstehen. Sie gehen unter, im Gehupe der vorbeifahrenden Autos oder in den Jubelschreien der kleinen Trump-Partymeute an der Hauptverkehrsstraße.
Pirozzolo will an diesem Sonntag nicht mit uns reden. Die Frage, wo man in Staten Island am Tag nach der Wahl am ehesten Trump-Supporter findet, quittiert er mit einem Nachäffen. „Überall“, fügt er später hinzu. Erst nach dem Sieg von Trump wird er uns zu sich in sein Haus einladen.
Staten Island ist einer der fünf Stadtbezirke von New York, es ist räumlich vom Rest der Stadt getrennt. Von Manhattan aus gibt es U-Bahnen nach New Jersey, nach Staten Island fahren die Schiffe im Halbstundentakt.
Die Insel wählt republikanischer als der Rest von New York. Hier leben deutlich weniger Menschen als in Manhattan oder Brooklyn, 3200 pro Quadratkilometer (in Brooklyn sind es 14 200). Lokale Blogs bezeichnen die Insel deshalb scherzhaft als „das echte Amerika“, die Bewohner selbst sprechen vom “vergessenen Viertel”. Es sind jene Menschen, an die Trump appelliert, wenn er in der Wahlnacht verspricht: “The forgotten men and women of our country will be forgotten no longer.” Die vergessenen Männer und Frauen in unserem Land werden nicht mehr vergessen sein.
Eine Frau mit Cowboyhut stampft die Straße entlang, als ob sie mit ihren Stiefelabsätzen den Beton aufbrechen könnte. „Wir sind die neuen Patrioten“, ruft sie. „Wie George Washington seinerzeit. Wir machen das alles, damit es keinen Bürgerkrieg gibt. Aber falls es einen geben sollte, dann bin ich dabei.“ Gegen Ende des Wahlkampfs sprach Trump wiederholt davon, dass die Wahl gefälscht werde – manche befürchteten Aufstände enttäuschter Trump-Fans, sollte er die Wahl verlieren.
Die Menschen, die an dieser Kreuzung stehen und mit der Presse reden, bezeichnen sich selbst als white-collar worker. Sie arbeiten also nicht in Fabriken, sondern in Bürotürmen, nicht mit Muskelkraft, sondern mit den Fingerspitzen. In Gesprächen erzählen sie, dass es ihnen selbst gutgehe, finanziell. Dass sie sich sorgen um die Zukunft des Landes. Trump betonte in seinen Reden nicht nur, dass er Jobs zurückbringen werde, sondern auch, wo diese Jobs landen werden: in den Händen der blue-collar worker, die wieder Stahl kochen werden in ihren Fabriken.

Illegale Einwanderung sei nun mal ein Problem, das nur Trump anspreche. Ob er die Mauer tatsächlich baut oder nicht, scheint keine Rolle zu spielen. Wichtig ist hier nur, dass er über die Grenze spricht. Vor allem, dass die Gesetze eingehalten werden, die Obama ihrer Ansicht nach außer Kraft gesetzt hat. Die Menschen in Staten Island erzählen, dass sie dankbar sind für einen Politiker wie Donald Trump.
Die Partymeute wedelt mit Trump-Schildern, zwei Stunden lang gibt es keinen Moment der Ruhe, die Menschen brüllen „Lock her up“ und „Build a Wall“. Als ein Polizeiauto vorbeifährt, die Fahrt verlangsamt und die Warnleuchte einschaltet, fassen das die Menschen als Unterstützung auf und johlen vor Glück. Polizisten, deren größte Gewerkschaft Trump als Präsidenten empfahl, bauen hier besonders gern ihre Häuser. “Blue Lives Matter”, rufen die Trump-Fans dem Polizeiauto hinterher, die Leben von Polizisten zählen. Es ist eine Abwandlung von “Black Lives Matter”. Mit diesem Slogan rückte in den vergangenen drei Jahren Polizeigewalt gegen schwarze Menschen in den Fokus.
Hin und wieder weht ein „Fuck Donald Trump“ aus einem der Autofenster in Richtung der Fankurve. „Law and Order, ihr Bastarde“, schreit eine der Trump-Frauen zurück. Sie ist jetzt in Fahrt. „Schaut mal, wie jämmerlich wir sind“, ruft sie. Jämmerlich, deplorable, sei die Hälfte der Trump-Wähler, hatte Hillary Clinton im Wahlkampf gesagt. Während die Frau weiterschimpft, schaltet die Ampel auf Grün, der Fahrer düst davon.
Am Wahltag gehen 57 Prozent der Stimmen aus Staten Island an Trump.
In den ersten Tagen nach der Wahl protestieren Tausende US-Demokraten, zumindest in den Regionen, die sich für Hillary entschieden haben. Zum Beispiel in New York, wo Menschen über Tage auf die Straße gehen. 25 000 waren es alleine am Samstag nach der Wahl. Egal, von wo aus in Manhattan sie starten, ihre Route führt am Trump Tower vorbei.
Sie rufen „Hands too small, can’t build a wall“. Mit seinen kleinen Händen werde es Trump gar nicht fertigbringen, eine Mauer zu bauen, soll das bedeuten. Seit 1998 ärgert sich Donald Trump über einen Artikel, in dem sich ein Journalist über seine angeblich kurzen Finger lustig machte, was Rückschlüsse auf andere Körperteile erlaube. Sie rufen „We reject - the president-elect“, wir lehnen den gewählten Präsidenten ab. „#notmypresident“ steht auf vielen Plakaten.
Die 33 Menschen in der Brooklyner Bar diskutieren knapp zwei Stunden. Darüber, wie die Demokratische Partei sich von dieser Niederlage erholen kann; wie Minderheiten in den USA geschützt werden können;
wie auf die Berichterstattung in den Medien Einfluss genommen werden kann. Und auch, wie man diese Kluft überwinden kann. Schließlich ist bald Thanksgiving. Für viele Menschen bedeutet das: Familienessen mit Trump-Wählern. Eine Frau sagt: „Ein Workshop wäre gut.“ Eine Anleitung zum Nichtausrasten, im besten Fall ein Wegweiser für Empathie.
In Staten Island fühlt es sich nach der Wahl hingegen so an, als hätte es nie einen Wahlkampf gegeben. In New York vergeht kaum eine Sekunde ohne schrillen Lärm, in Staten Island ist es eine Überraschung, wenn in Wohngegenden mehr als fünf Menschen nebeneinander stehen. Wer sein Haus verlässt, geht schnurstracks in Richtung Auto. Fußgängerwege enden im Nichts.
Ein älterer Herr sitzt, eine Zigarre rauchend, in seiner Garage, fast schon klischeehaft weht die US-Flagge von seinem Haus. Klar habe er Trump gewählt und auf keinen Fall wolle er mit Namen zitiert werden. In Staten Island werde sich niemand mit Name und Gesicht vor eine Kamera stellen. „Die würden nur Ärger mit ihren Chefs bekommen“, sagt der Mann. Liberale Zeitungen wie die New York Times würde er nicht mal für seinen Vogelkäfig verwenden - das habe er auch so gesagt, als ihm ein Testabo angeboten wurde. Er nennt die Protestierenden Anarchisten. Auf Fox News werden Bilder aus Portland gezeigt, wo es anfangs zu Ausschreitungen kam. Größtenteils blieben die Demonstrationen jedoch friedlich.
Sam Pirozzolo hat in sein Haus eingeladen, nun da Trump gewonnen hat. Er lebt hier gemeinsam mit seiner Frau, zwei Kindern, Hund und Katze. Er arbeitet als Optiker und kommt am Sonntagmorgen um neun Uhr vom Gassigehen zurück. Bis vor Kurzem stand vor seinem Haus ein dreieinhalb Meter großes T - für Trump. Es wurde angezündet. Als Donald Trump das mitbekam, rief er Pirozzolo an, keine 24 Stunden später.
Auch Pirozzolo findet die Demonstrationen gegen Trump unnötig. Sie seien organisiert von Menschen, die in ihrer Kindheit Fußball gespielt hätten, ohne Tore zu zählen. “Sie haben noch nie in ihrem Leben verloren. Nun wurde ein Präsident gewählt, und sie wollen einen Trostpreis.”
“Die Leute haben es satt, ausgenutzt und angelogen zu werden”, sagt Pirozzolo. “Wir kümmern uns besser um Ausländer als um Bürger dieses Landes.” Trump wolle sich zuerst um Amerikaner kümmern.
Es sei nun wichtig, gemeinsam an einem Strang zu ziehen, sagt Pirozzolo. Wie das passieren soll, darauf weiß er nicht so recht zu antworten. Dass sich Muslime eingeschüchtert fühlen, nennt er “unglücklich”, aber dafür sei die Berichterstattung der Medien verantwortlich. Dass Trump anti-muslimische Vorurteile bedient und “vielen” Flüchtlingen unterstellt hatte, so zu denken wie Omar Mateen, der bei einem Attentat in Florida 49 Menschen umgebracht hatte: In der Weltsicht von Pirozzolo trifft Trump so gut wie nie die Schuld. Einzig bei Donald Trumps Aussage, wenn man ein Star sei, ließen Frauen alles mit sich machen, sich auch an die „Pussy“ fassen, gibt es keine Auswege. Auch diese Äußerungen nennt Pirozzolo “unglücklich”, schiebt aber hinterher, dass der Moderator durch seine Gesprächsführung Trump zu solchen Aussagen gedrängt habe. Ansonsten interessiere es ihn nicht weiter.
In den ersten Tagen nach der Wahl von Trump wurden der Anti-Rassismus-Gruppe Southern Poverty Law Center mehr als 300 Vorfälle gemeldet, wie CNN berichtet. Einer muslimischen Frau wurde gedroht, sie anzuzünden, sollte sie ihr Kopftuch nicht abnehmen. Eine jüdische Frau schrieb in einem Facebook-Beitrag über einen antisemitischen Vorfall: Ein Mann habe ihr während einer U-Bahnfahrt mitgeteilt, dass man “die schönen Jüdinnen nicht festnehmen” werde. In Chicago wurde eine weiße Person brutal zusammengeschlagen. In seinem ersten TV-Interview sagte Trump, dass ihn solche Botschaften traurig machten: “Falls es helfen sollte, dann werde ich es sagen, und ich werde es direkt in die Kamera sagen: Hört damit auf!”
Doch ob diese Worte ausreichen werden, um die Kluft zwischen Anhängern beider Parteien zu überbrücken, ist fraglich. Oft ist nun die Forderung zu hören, Trump eine Chance zu geben. Die gängige Reaktion seiner Gegner in sozialen Netzwerken lässt sich in einem Emoji zusammenfassen: Es ist eine Uhr. Sie zählt die Sekunden, die vergehen, bis Trump seine Chance verspielt hat.
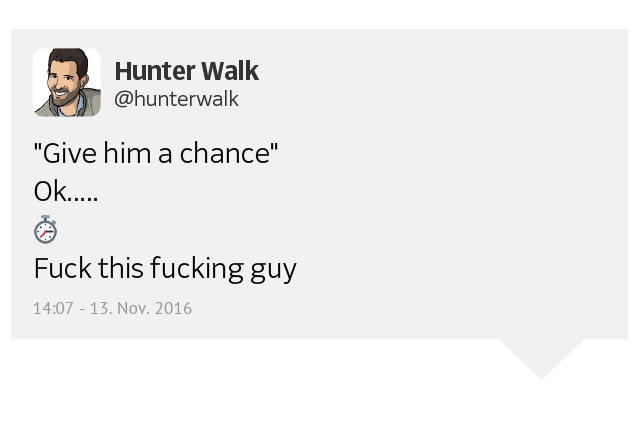
In den Tagen nach der Wahlniederlage haben sich Bürger der Stadt New York dafür entschieden, dass ein Zwischengeschoss, das U-Bahn-Haltestellen miteinander verbindet, ein idealer Ort für Protest sein kann. Am Union Square - dort starteten auch die Occupy-Proteste - fing ein Künstler damit an, Post-it-Zettel mit Botschaften an die Wand zu kleben. Zehntausende Passanten haben es inzwischen nachgemacht. Die Botschaften sind überwiegend positiv und rufen ihre Leser dazu auf, zu handeln. “Ich werde nicht aufhören, für unsere Umwelt zu kämpfen!” steht auf einem Zettel. “Ich bin noch immer für Hillary”, “Kümmert euch um die, die eure Liebe und Unterstützung brauchen”, “Es gibt Farbe, es gibt Licht”, und “Ein ganz großes Fick Dich an 2016” steht dort ebenfalls.
Der Durchgang ist auch abends um zehn noch überfüllt. Ein freiwilliger Helfer läuft mit Filzstiften und Post-its die gut 25 Meter lange Wand (sie wächst täglich) entlang. “Manche Menschen glauben, dass Einigkeit nicht klappt. Ich gehöre nicht dazu”, sagt er. Eine Reinigungskraft kehrt Post-its zusammen. “Dumme Heulsusen”, sagt er vor sich hin. Sofort sucht der Helfer ein Gespräch mit ihm. Als sie sich trennen, beide halb zufrieden, nähert sich eine Frau dem Helfer. Die Botschaften haben sie sichtlich mitgenommen, sie wischt sich Tränen aus den Augen. Beide umarmen sich.